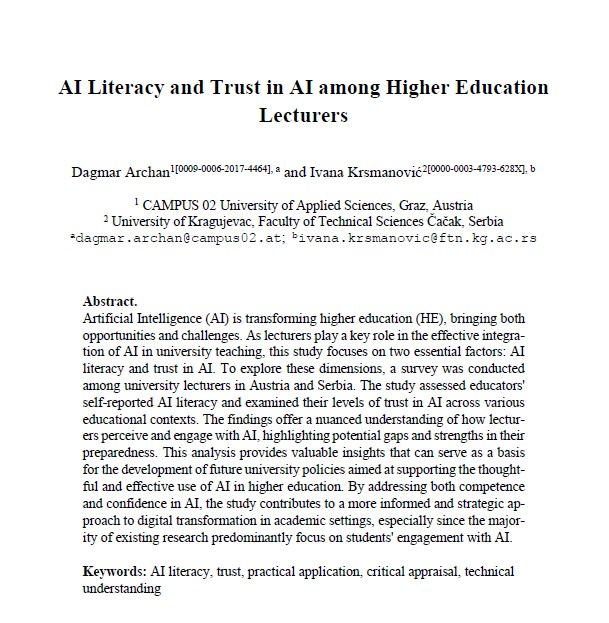
Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Hochschullehre. Lehrende müssen KIKompetenzen entwickeln, um Studierende zukunftsorientiert zu begleiten. Doch was bedeutet AI literacy? Der Beitrag diskutiert Definitionen und präsentiert Umfrageergebnisse aus Österreich und Serbien. Diese zeigen: Ein solides Grundverständnis ist vorhanden, spezifisches Wissen fehlt mitunter. Herkunft oder akademischer Grad beeinflussen das Kompetenzniveau kaum. KI wird primär zur Vorbereitung verwendet; Potenziale bleiben oft ungenutzt. In den letzten Monaten sind viele Best Practice-Beispiele entstanden – nun gilt es, institutionelle
Rahmenbedingungen zu schaffen, um diese flächendeckend zu etablieren.
The goal of this research study was to evaluate how Teaching presence, as a Community of Inquiry (CoI) construct, could help establish more inclusive blended learning classrooms in English language teaching (ELT) and whether educators need additional support to enhance inclusivity in their classrooms. An explanatory mixed-method study was conducted, investigating the relationship between teachers’ teaching presence, their inclusive practices, and future training needs in blended learning environments. Data were collected from 68 ELT educators worldwide via a survey comprising the CoI questionnaire and an original inclusive practices scale. The study revealed that educators generally possess high confidence in facilitating and guiding blended learning, reflecting strong perceived capability in fostering inclusive environments. Positive correlations were found between Teaching presence and various measures of inclusive practice, indicating that stronger teaching presence enhances educators’ readiness and confidence in inclusive practices. However, many educators reported insufficient preparation and support for inclusive blended learning, highlighting the need for more comprehensive professional development and targeted resources. The findings emphasize the importance of integrating the CoI design principles and leveragingtechnology to enhance inclusivity. Overall, the study underscores the necessity of embedding the creation and maintenance of inclusive environments as fundamental components of educator training programs, aligning with the broader goals of inclusive digital education
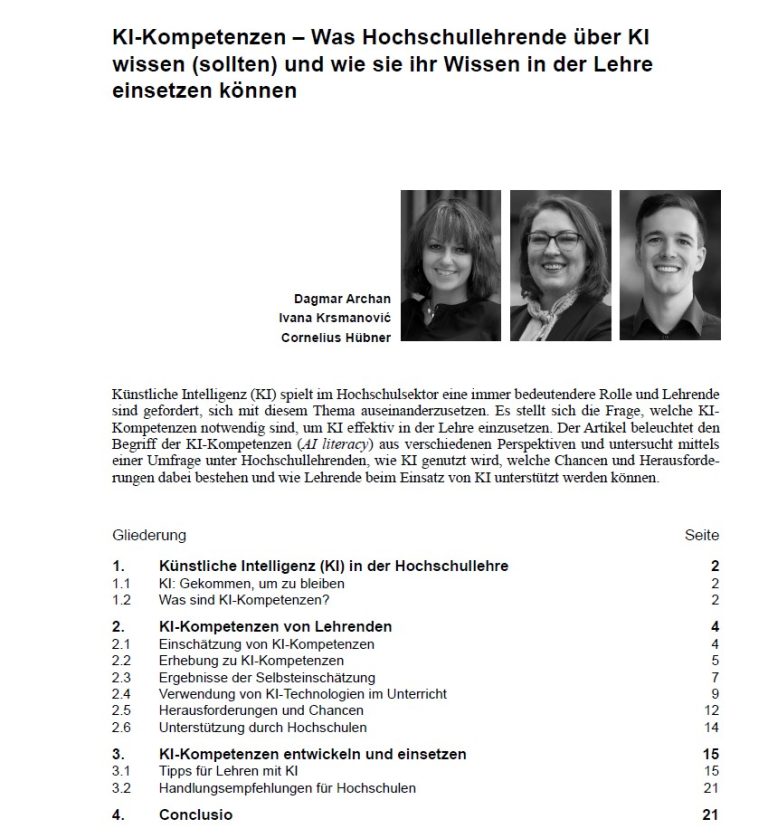
Künstliche Intelligenz (KI) spielt im Hochschulsektor eine immer bedeutendere Rolle. Lehrende sind gefordert, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Es stellt sich die Frage, was unter KI-Kompetenzen zu verstehen ist und über welche KI-Kompetenzen Lehrende verfügen müssen, um KI zielgerichtet in ihrem Unterricht einzusetzen. In diesem Artikel wird der Begriff der KI-Kompetenzen (AI literacy) von verschiedenen Seiten beleuchtet und die Autor*innen erforschen basierend auf einer Umfrage unter Hochschullehrenden, wie Lehrende KI verwenden, welche Chancen und Herausforderungen sie dabei sehen und was getan werden kann, um sie beim Einsatz von KI in der Hochschullehre zu unterstützen.

Um sich in emergenten Kontexten erfolgreich zu behaupten, müssen Studierende über sogenannte Zukunftskompetenzen oder Future Skills verfügen. Auch Lehrende, die diese Kompetenzen vermitteln und gemeinsam mit den Lernenden erarbeiten sollen, müssen ihre Future Skills schärfen. Der eCampus, ein eService für Lehrende, kann Lehrpersonen bei der Entwicklung und Vermittlung verschiedener Future Skills unterstützen. Basierend auf Ehlers’ (2020) Definition von Future Skills wird in diesem Artikel der eCampus und sein Potenzial für die Entwicklung und Vermittlung von Future Skills vorgestellt.
Dieser Artikel erschien im fnma Magazin zum Thema Erfahrungen mit KI in der Lehre. Der Beitrag behandelt die Veranstaltung KI-Frühstück, in dessen Rahmen ein Diskurs über Künstliche Intelligenz mit Lektor*innen stattfand. Die Ergebnisse des Erfahrungsaustausches der Themenbereiche KI und zukünftige Qualifikationsprofile, KI im Unterricht, KI in der Leistungsbeurteilung und KI und schriftliche Arbeiten werden vorgestellt.
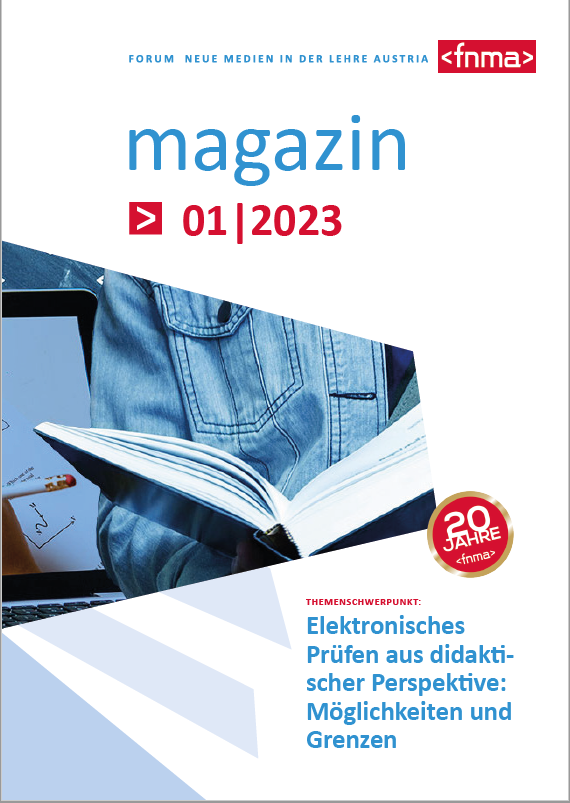
Dieser Artikel erschien im fnma Magazin zum Thema “Elektronisches Prüfen aus didaktischer Perspektive: Möglichkeiten und Grenzen”. Der Beitrag behandelt die Umsetzung von ursprünglich analogen englischen Reading-Formaten im Moodle Test, wie sie in einer Englisch-Lehrveranstaltung an der FH CAMPUS 02 umgesetzt wurden. Es werden einige Möglichkeiten und deren Vor- und Nachteile beleuchtet, diese Formate mithilfe der unterschiedlichen Fragetypen in einen online Moodle Test umzuwandeln. Schließlich wird darauf eingegangen, wie die Readings tatsächlich umgesetzt wurden und weshalb.

Die Digitalisierung hat spätestens seit der Covid-19-Pandemie und Semestern voller Online- oder Hybridlehre endgültig Einzug in die Hochschullehre gehalten und ist auch nicht mehr wegzudenken. Die digitalen Kompetenzen von Studierenden werden im Hochschulalltag häufig in den Fokus gerückt – beispielsweise durch Lernzieldefinitionen im Rahmen von Curricula oder durchaus breit angelegte Forschungsprojekte (siehe dazu beispielsweise Janschitz et al. 2021) – jedoch stellt sich auch die Frage, wie es um die digitalen Kompetenzen der Lehrenden bestellt ist und wie diese sich auf die Lehre auswirken. In diesem Artikel wird, basierend auf einer Beschreibung und Definition des Konzepts der digitalen Kompetenzen, eine Umfrage bei nebenberuflich Lehrenden einer Fachhochschule zum Thema digitale Kompetenzen analysiert und diskutiert. Ausgehend von dieser Studie werden Maßnahmen aufgezeigt, die Hochschulen treffen können, um Lehrende bestmöglich bei der Ausbildung und Steigerung ihrer digitalen Kompetenzen zu unterstützen.
Dieser Beitrag zum 21. E-Learning-Tag der FH JOANNEUM diskutiert, inwiefern „Digital Storytelling“ Emotionen von Hochschulstudierenden evozieren und Lernprozesse intensivieren kann. Zunächst wird das Konzept der emotionalen Intelligenz in Zusammenhang mit kontemporären Ansichten auf das Lernen vorgestellt. In Folge wird „Digital Storytelling“ als Lehr- und Lernmethode beschrieben und es wird anhand einer Befragung von Studierenden analysiert, ob und wie diese mit Emotionen durch „Digital Storytelling“ umgehen. Es zeigt sich, dass „Digital Storytelling“ Emotionen im Lernprozess hervorruft – diese führen nach Ansicht der Befragten jedoch nicht notwendigerweise zur Verbesserung des Lernprozesses, können sich aber durchaus motivierend auswirken.
Gutes Feedback zu definieren und dann noch gut zu kommunizieren, ganz egal ob die Kommunikation schriftlich oder mündlich erfolgt, ist gerade im Hochschulbereich nicht unproblematisch. Wieso Feedback so ein komplexes Unterfangen ist, was gutes Feedback ausmachen sollte und wie ebendieses im Zusammenspiel mit Emotionen wirkt, wird in diesem Beitrag zum 21. E-Learning-Tag der FH JOANNEUM erläutert.